Meschede/Aeishen & Kolleg*innen
Gemeinschaftspraxis für Urologie
Andrologie,
medikamentöse Tumortherapie
Wittener Straße 40
44575 Castrop-Rauxel
Telefon
02305 / 43427
oder
02305 / 24602
Die Öffnungszeiten der Praxis
Mo - Do: 08:00 - 11:30 Uhr und 15:00 - 17:30 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Fr: 08:00 - 14:30 Uhr durchgehend
Mitgliedschaften
- deutsche Krebsgesellschaft
- deutsche Gesellschaft für Urologie
- deutsche Gesellschaft für Andrologie
- onkolog. Arbeitskreis Emscher-Lippe
- europäische Gesellschaft für Urologie (EAU)
- nordrhein-westfälische Gesellschaft für Urologie
Onkologie
ambulante medikamentöse Tumortherapie bei Nieren,Blasen und Prostatakrebs
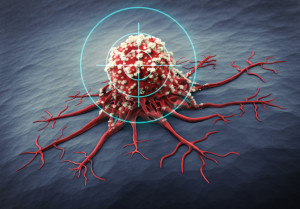
Die Onkologie ist der Zweig der Medizin, der sich gezielt und spezialisiert mit bösartigen Erkrankungen (Krebs) befasst. Einen Schwerpunkt unserer Praxis bilden die Krebsfrüherkennung, die Therapie (z.B. ambulante Chemotherapie) und die Nachsorge von malignen (bösartigen) Erkrankungen.
|
Bei klinischem Verdacht auf das Vorliegen eines Prostatakarzinoms – etwa aufgrund eines suspekten digitalen rektalen Tastbefundes, auffälliger sonographischer Befunde oder eines pathologisch erhöhten PSA-Wertes (Prostataspezifisches Antigen) – erfolgt die Diagnosesicherung regelmäßig mittels histologischer Untersuchung durch Prostatastanzbiopsie.
In der gegenwärtigen klinischen Praxis wird allen Patienten mit begründetem Karzinomverdacht im Regelfall zunächst eine multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) der Prostata angeboten. Diese bildgebende Diagnostik dient der genaueren anatomischen und funktionellen Darstellung suspekter Areale innerhalb des Prostatagewebes und erlaubt eine differenzierte Risikoabschätzung hinsichtlich einer möglichen Malignität.
Basierend auf den Ergebnissen der MRT-Untersuchung erfolgt – sofern ein entsprechender Verdachtsmoment durch die Bildgebung erhärtet wird – in einem zweiten Schritt die Durchführung einer sonographisch gesteuerten Fusionsbiopsie. Hierbei werden die im MRT identifizierten suspekten Läsionen mit den in Echtzeit erhobenen transrektalen Ultraschallbildern fusioniert, um eine gezielte und hochpräzise Gewebeentnahme zu ermöglichen.
Die sich an die Diagnostik anschließende therapeutische Entscheidung wird auf Grundlage einer individuellen Risikobewertung getroffen. Hierbei sind insbesondere das biologische Alter sowie der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten, das klinische und bildgebende Tumorstadium (TNM-Klassifikation), der Gleason-Score bzw. ISUP-Grad sowie weitere histopathologische Merkmale von maßgeblicher Bedeutung.
Therapie:
In Abhängigkeit dieser Parameter kann das therapeutische Vorgehen ein aktives Überwachungsverfahren („active surveillance“), eine kurative radikale Prostatektomie, eine Strahlentherapie oder – in fortgeschrittenen Fällen – eine systemische Therapie umfassen. Die Auswahl der Therapieform erfolgt dabei stets leitliniengerecht unter Abwägung der medizinischen Notwendigkeit sowie der individuellen Patientenpräferenzen im Rahmen eines interdisziplinären onkologischen Konsils.
Etwa 90% der Harnblasenkarzinome sind Urothelkarzinome und entwickeln sich ausgehend vom Deckgewebe der Blase (Urothel). Seltener sind Plattenepithel- und Adenokarzinome. Das Harnblasenkarzinom zählt zu den häufigsten Krebsarten. Männer erkranken dreimal häufiger als Frauen. Erkrankungen treten gehäuft ab dem 40. Lebensjahr auf und haben ihr Maximum im 6. und 7. Lebensjahrzehnt. Die wichtigsten Risikofaktoren sind der Zigarettenkonsum, der berufliche Kontakt mit Schadstoffen (aromatische Amine) und der Gebrauch bestimmter Medikamente (Cyclophosphamid, Phenacetin).
Die typischen Leitsymptome sind eine schmerzlose Makrohämaturie (sichtbare Blutabgänge mit dem Urin), oder eine mittels Teststäbchen nachgewiesene Mikrohämaturie (nicht sichtbare Blutbeimengungen). Bei größeren Tumoren und fortgeschrittenen Erkrankungen können auch Beschwerden beim Wasserlassen, Flankenschmerzen, Blutarmut und eine Gewichtsabnahme hinzutreten.
Entscheidend für die Diagnostik ist die Durchführung einer Blasenspiegelung (Zystoskopie). Zur Abklärung des oberen Harntraktes (Harnleiter, Nierenbecken) erfolgt eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittelgabe (Ausscheidungsurographie). Weitere wichtige diagnostische Mittel sind die Durchführung eines CT`s (Metastasierung?, Tumorausdehnung) und die Anfertigung einer Urinzytologie (Suche nach Krebszellen im Urin).
Therapie:
Entscheidend für die Therapie ist das Tumorstadium (pTNM Klassifikation), welches neben der Eindringtiefe und der Ausdehnung auch die Differenzierung eines Tumors (Grading) angibt.
Bei Verdacht auf einen Harnblasentumor erfolgt die transurethrale Elektroresektion des Tumors. Dabei wird dieser elektrisch über die Harnröhre abgeschält und das entfernte Material feingeweblich vom Pathologen untersucht. In den meisten Fällen ist auf diese Weise eine komplette Entfernung möglich. Liegt jedoch eine hohe Eindringtiefe des Tumors oder eine schlechte Tumordifferenzierung (Grading) vor, sollte eine Zystektomie (Blasenentfernung mit Harnableitung) erfolgen.
Bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen oder inoperablen Patienten (Alter, Allgemeinzustand) kann eine Bestrahlung in Kombination mit einer Chemotherapie erwägt werden.
Wegen häufiger Rezidive (Wiederauftreten) ist eine engmaschige Tumornachsorge unverzichtbar.
Nierenkrebs ist relativ selten. Es können verschiedene Tumorarten unterschieden werden. Am häufigsten ist das Nierenzellkarzinom (Hypernephrom). Es ist eine bösartige Erkrankung die vom Funktionsgewebe der Niere ausgeht. Männer erkranken dreimal häufiger als Frauen, wobei der Häufigkeitsgipfel im 40-70. Lebensjahr liegt. Ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht für Raucher, bei chronischer Niereninsuffizienz, angeborenen Nierenerkrankungen (z.B. Von-Hippel-Lindau-Syndrom, tuberöse Sklerose), langjährigem Gebrauch bestimmter Schmerzmittel, sowie bei Dialysepatienten und Nierentransplantierten. Bestimmte Umweltfaktoren (Blei, Asbest, aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen, Alkohol, Übergewicht) scheinen ebenfalls in der Entstehung eine Rolle zu spielen. Beschwerden, wie Blut im Urin, Flankenschmerzen, Gewichtsverlust oder ein tastbarer Tumor in der Flanke, treten erst in fortgeschrittenen Tumorstadien auf. Meist werden Nierentumoren zufällig im Rahmen von bildgebenden Untersuchungen (CT, MRT oder Ultraschall) entdeckt. Bei Tumorverdacht ist die operative Nierenfreilegung mit intraoperativer Gewebeuntersuchung die Therapie der Wahl. Eine Probeentnahme von außen (Feinnadelbiopsie) sollte wegen der möglichen Tumorzellverschleppung nicht erfolgen und bleibt Einzelfällen vorbehalten.
Therapie:
Die organerhaltende Nierenteilresektion stellt heute die Standardtherapie bei lokal begrenztem Nierenzellkarzinom dar – auch bei normaler Funktion der Gegenseite. Sie kann offen-chirurgisch, laparoskopisch oder roboterassistiert erfolgen und ermöglicht den Erhalt funktionsfähigen Nierengewebes bei vollständiger Tumorentfernung.
Eine radikale Tumornephrektomie (komplette Entfernung der betroffenen Niere) ist nur bei größeren, zentral gelegenen Tumoren oder ungünstiger anatomischer Lage indiziert, wenn eine Teilresektion nicht durchführbar ist.
Bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom kommt heute eine systemische Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren und Tyrosinkinaseinhibitoren zur Anwendung. Die früher übliche Immunchemotherapie ist aufgrund unzureichender Wirksamkeit obsolet. Die Auswahl der Therapie erfolgt leitliniengerecht unter Berücksichtigung individueller Risikofaktoren im interdisziplinären Tumorboard.
Hodentumore stellen die häufigste bösartige Tumorerkrankung des jungen Mannes zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr dar. Jede Schwellung im Bereich des Hodens (Tastuntersuchung) sollte weiter abgeklärt werden. Bei rechtzeitigem Erkennen ist selbst bei einer bereits erfolgten Metastasierung eine nahezu 100%ige Heilungschance zu erwarten.
Neben einer meist schmerzlosen Hodenschwellung können bei fortgeschrittenen Erkrankungen Rückenschmerzen, eine Brustdüsenvergrößerung, Gewichtsabnahme oder Bluthusten bei Lungenmetastasen hinzutreten.
Zur Diagnostik erfolgen die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung des Hodens und die Bestimmung von Tumormarkern (AFP, ß-HCG, LDH) im Blut.
Therapie:
Bei jedem Verdacht auf eine bösartige Neubildung (Veränderungen im Ultraschall, Erhöhung der Hodentumormarker) hat eine operative inguinale Freilegung des Hodens mit Schnellschnittdiagnostik zu erfolgen. Bestätigt der Pathologe den Verdacht, muss der betroffene Hoden entfernt werden. Je nach Tumortyp (90 % sind Keimzelltumoren) und Tumorstadium müssen ggf. weitere Maßnahmen (Bestrahlung, Chemotherapie, Entfernung von Lymphknoten) durchgeführt werden.




